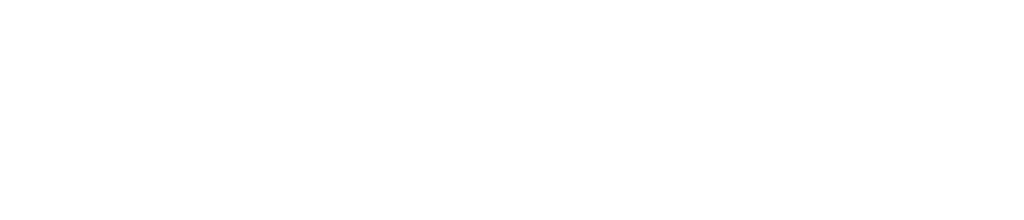Hintergrund:
„MEIN UNGLÜCKLICHES BEWUSSTSEIN“
Martin GADOW beantwortet Fragen zu seinem Roman „DER WIDERSPRUCH“
FRAGE: Martin, du warst vor Deiner Verrentung fünfzehn Jahre als Bezirksgeschäftsführer beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. beschäftigt; einem gemeinnützigen Verein, der den Bau, die Bauunterhaltung und Pflege von deutschen Soldatenfriedhöfen im Ausland verantwortet und Workcamps für Jugendliche auf deutschen Kriegsgräberstätten durchführt. Ist der im Roman erwähnte Kriegsgräberverein mit dem Volksbund identisch?
GADOW: Es stimmt, ich war dort fünfzehn Jahre als Geschäftsführer tätig. Dennoch ist der im Roman erwähnte Kriegsgräberverein nicht mit dem Volksbund gleichzusetzen. Der Kriegsgräberverein ist ein ebensolches literarischen Konstrukt wie die dort auftretenden Figuren. Ich habe keinen Tatsachenbericht verfasst. Ich habe einen Roman geschrieben – mein Buch soll jedenfalls einer sein.
FRAGE: Die gleiche Frage wollte ich ursprünglich mit Blick auf das Romanpersonal stellen. Ob nämlich die im Roman geschilderten Figuren realen Personen entsprechen. Mit anderen Worten: Handelt es sich um einen Schlüsselroman? Aber das ist wohl – parallel zu der nicht vorhandenen Entsprechung des Volksbunds mit dem Kriegsgräberverein – nicht anzunehmen, oder?
GADOW: Ein literarischer Text wird immer nur zur Hälfte vom Verfasser verantwortet. Die andere Hälfte liefert die Phantasie des Lesers. Ich bin für den Text des Romans, nicht für die Phantasie des Lesers verantwortlich. Literarische Figuren sind fiktiv. Sofern der Leser meint, hinter meinen Figuren reale Personen erkennen zu sollen, kann ich dagegen nichts einwenden.
FRAGE: Orientiert sich die Handlung des Romans an tatsächlichen Geschehnissen?
GADOW: Wie gesagt: Ich habe keinen Tatsachenbericht, sondern einen Roman verfasst. Schon Aristoteles wusste, dass nur der Historiker daran interessiert ist, die Wahrheit zu schreiben; also darzustellen, „wie es gewesen“. Der Verfasser von literarischen Texten erzählt, wie es gewesen sein könnte. Die entscheidende Frage lautet also nicht, ob es wahr ist, was im literarischen Text zu lesen ist, sondern ob das, was im Text steht, wahrscheinlich ist. Das Qualitätskriterium des literarischen Textes ist nicht die Wahrheit, sondern die Wahrscheinlichkeit dessen was erzählt wird.
FRAGE: Die Abschilderung sowohl der Geschehnisfolge als auch der Figuren Deines Romans hat demnach nichts mit der Wirklichkeit zu tun?
GADOW: Der Verfasser eines literarischen Textes schreibt oftmals über das, was er aus eigener Anschauung kennt. Dafür gibt es Beispiele. Hermann Lenz erzählt mit Blick auf seinen Protagonisten Eugen Rapp in den autobiographischen Romanen seines Zyklus „Vergangene Gegenwart“ (9 Bände) entlang seiner eigenen Lebensgeschichte. Autobiographische Romane wie „Nacht“, „Die Abenteuer des Ruben Jablonski“ oder „Fuck America – Bronskys Geständnis“ von Edgar Hilsenrath erzählen Hilsenraths persönliches Schicksal als Gefangener im Ghetto (das Thema von „Nacht“), Auswanderer nach Israel („Die Abenteuer des Ruben Jablonski“) oder Romanautor in Amerika (Thema von „Fuck America“ ist Hilsenraths Niederschrift seines Romans „Nacht“). In seinem autobiographischen Exilroman „Die Wenigen und die Vielen“ nennt der Autor Hans Sahl sein Alter Ego Georg Kobbe.
FRAGE: Agiert deine Figur Peter Leibgeber als Alter Ego von Dir als Geschäftsführer beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge?
GADOW: Ja, und zwar in der Weise, wie Eugen Rapp als Alter Ego seines Autors Hermann Lenz agiert. Ja, insofern Ranek (Protagonist in „Nacht“), Ruben Jablonski oder Bronsky als Alter Ego ihres Autors Edgar Hilsenrath auftreten. Mein Roman ist keine Autobiographie. „DER WIDERSPRUCH“ ist ein autobiographischer Roman. In der Autobiographie sind das erzählte Ich und das erzählende Ich identisch. Nicht so im autobiographischen Roman: das erzählte Ich (der Protagonist) entspricht nicht dem erzählenden Ich (dem Autor). Der Autor des autobiographischen Romans kann Ereignisse nicht nur weglassen, sondern auch erfundene Begebenheiten hinzufügen. Er kann die zeitliche Abfolge von Geschehnissen umstellen und authentische Schauplätze der Handlung verändern. Das gilt auch dann, wenn statt einer Ich-Erzählsituation eine personale Erzählsituation als Erzählperspektive gewählt wird.
FRAGE: Du erwähnst in Deinem Roman „DER WIDERSPRUCH“ den Literaturwissenschaftler Hans Mayer, der in seinem umfangreichen Werk immer wieder Hegel zitiert. Hegel spricht in seiner „Phänomenologie des Geistes“ vom „unglücklichen Bewusstsein“; eine Zustandsbeschreibung, die Du auf Deinen Protagonisten Peter Leibgeber überträgst. Die Formulierung „‘Das unglückliche Bewusstsein‘ (HEGEL – zitiert nach Hans Mayer)“ durchzieht Deinen Roman wie ein Refrain.
GADOW: Hans Mayer spricht in seinen Frankfurter Vorlesungen, 1987 unter dem Titel „Gelebte Literatur“ erschienen, vom „intentionellen Außenseitertum eines schöpferischen Dissidenten“, welches ihn dazu veranlasst habe, die Erfahrung des „unglücklichen Bewusstseins“ als Eigenerfahrung zu verstehen. Leibgeber tut bei seiner Tätigkeit als Organisationsleiter des Kriegsgräbervereins das Falsche und strengt sich auch noch richtig dabei an. Das ist sein „unglückliches Bewusstsein“.
FRAGE: Könntest du das etwas näher erläutern? Warum ist Leibgeber unglücklich? Was stört ihn am Kriegsgräberverein?
GADOW: Die Kritik Leibgebers am Kriegsgräberverein kann man in vier Thesen zusammenfassen. Erstens: Der Kriegsgräberverein bezeichnet die Kriegstoten unisono als „Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“. Die Täter werden weggelogen. Das Opfernarrativ – zumal das soldatische – ist wesentlicher Inhalt der Gedenk- und Erinnerungskultur dieses Vereins. Zweitens: Der Kriegsgräberverein wirft Opfer und Täter in ein großes Massengrab und gießt – getreu seinem Leitwort „Versöhnung über den Kriegsgräbern“, die er als „Friedenseinsatz“ ausgibt – die süße Soße der Versöhnung darüber. Wer Versöhnung als Chiffre für das Verleugnen der Täter verwendet, verantwortet Volksverdummung anstatt Friedeneinsätze. Drittens: Das beharrliche Umlügen des Kriegsgräbervereins von historischen Mittätern, Kriegsverbrechern und Massenmördern in Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft bedeutet die Verleugnung der historischen Wahrheit und einen Angriff auf die intellektuelle Klarheit. Viertens: Die Vereinsvertreter agieren als Steigbügelhalter am Schlachtross der Regierung. Das haben sie unterm Nationalsozialismus getan, das haben sie im Kalten Krieg getan, das tun sie in der Handlungsgegenwart. Peter Leibgeber, der Protagonist meines Romans, kann sich weder mit der falschen Verbandspolitik noch der verlogenen Versöhnungsphilosophie noch der fatalen Vereinsgeschichte des Kriegsgräbervereins identifizieren. Weil Leibgeber nicht mit einem leergesoffenen Pappbecher im Kölner Hauptbahnhof betteln gehen will, schließt er einen faustischen Pakt: Nahrung, Kleidung und Obdach gegen die totale Selbstverleugnung. Um zu überleben tarnt er seine Überzeugungen, täuscht seine Umwelt und trickst sich durchs Berufsleben. In das graue Gefieder seiner Anzüge gekleidet, plappert er wie ein Papagei Vereinsparolen nach („Versöhnung!“ „Versöhnung!“ „Versöhnung!“). Er wird gefüttert. Er wird getränkt. Aber vom Fliegen kann er sich seinem Käfig nur träumen.